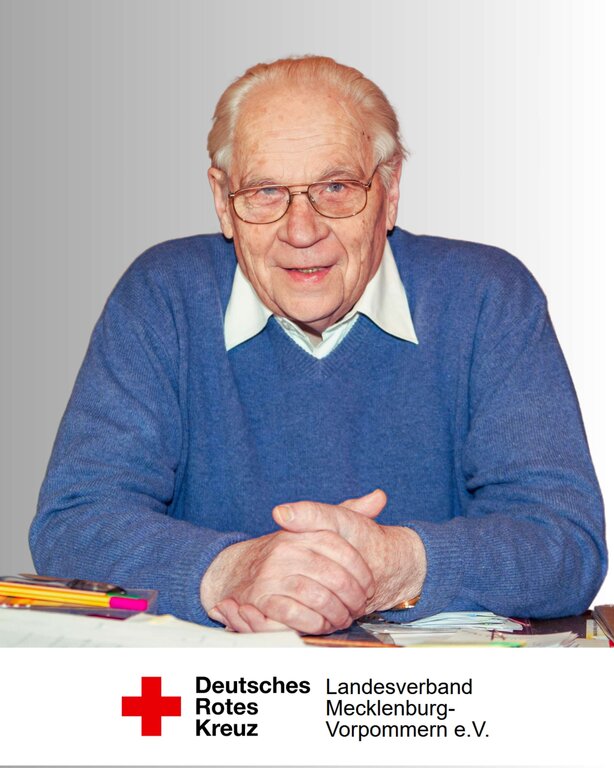1. Herr Professor Dr. Akkermann, Sie werden im Februar 90. Jahre und blicken auf ein Leben voller Veränderungen und Herausforderungen. Was empfinden Sie, wenn Sie all diese Momente Revue passieren lassen? Gibt es einen, der besonders herausragt?
„Zunächst danke ich für die Blumen. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe mich nicht als ein übergroßes Talent, sondern als jemanden, der hart gearbeitet hat, um zu seinen Erkenntnissen zu gelangen. Aber auf die Frage, welche Momente aus meinen fast neun Lebensjahrzehnten besonders herausragen, gibt es zwei Dinge, die ich hervorheben möchte:
Das Erste ist, dass ich in den 1980er Jahren tatsächlich Einfluss auf die weltpolitische Entwicklung nehmen konnte. Als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes der DDR und als Vizepräsident der Medizinischen Kommission des Internationalen Roten Kreuzes war ich Teil der zweiten Weltrotkreuz-Friedenskonferenz 1984 auf den Åland-Inseln. Dort gelang es mir – gegen viele Widerstände – die Ächtung der Weltraumrüstung in die Abschlussresolution einzubringen. Niemand glaubte, dass das möglich sei, aber ich habe dafür gekämpft, und schließlich wurde diese Resolution weltweit angenommen, sogar vom US-amerikanischen Roten Kreuz. Ich bin überzeugt, dass dies dazu beigetragen hat, die Konfrontation zwischen Ost und West zu entschärfen und den Kalten Krieg friedlich zu beenden.
Das Zweite, was ich besonders herausstellen möchte, betrifft meine Erkenntnisse über die Entwicklung der Menschheit. In meinem Buch „Die ewige Sehnsucht“ habe ich beschrieben, wie die Geschichte in Zyklen verläuft – von Aufstieg und Wohlstand über soziale Ungleichheiten bis hin zu Krisen und Revolutionen. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Menschheit lernen muss, eine Balance zwischen Fortschritt und Stabilität zu finden, um Katastrophen zu vermeiden. Das Verständnis dieser Zyklen und wie sie unser Leben prägen, sehe ich als eine meiner wichtigsten Erkenntnisse.“
2. Sie sind nahe Riga geboren und kurz nach Ausbruch des 2. Weltkrieges nach Deutschland geflüchtet. Ihre Kindheit war geprägt von Flucht, Neuanfängen und einer Welt im Wandel. Wie haben diese Erfahrungen Sie als Mensch geformt und Ihnen geholfen, auch in schwierigen Zeiten immer wieder nach vorne zu schauen?
„Ich bin Deutschbalte, geboren in Schaulen, einer Stadt im Norden von Litauen, nahe Riga. Unsere Familie war Teil der hanseatischen Kaufmanns- und Handwerkstradition in Riga. Meine Kindheit war von vielen Geschichten geprägt, die mir während der Nachkriegszeit erzählt wurden, besonders in den dunklen Abenden 1945 und 1946, als die Familie bei Kerzenlicht zusammensaß. Diese Erzählungen, die ich als Einzelkind von den Erwachsenen hörte, haben mein Denken nachhaltig geprägt.
Das Leben der Deutschbalten war ein Leben in Widersprüchen: Einerseits lebten wir in Wohlstand, andererseits war dieser Wohlstand stets gefährdet – wir lebten 'auf Rasierklingen'. Diese Erfahrung hat meinen Geist geschult, mich beweglich gemacht und mir beigebracht, flexibel zu sein. Sie hat mich auch gelehrt, mir Wissen und Erfahrungen anzueignen, um in schwierigen Situationen bestehen zu können.
Die Flucht nach Deutschland im Jahr 1939 war keine Flucht im eigentlichen Sinne, sondern eine Umsiedlung. Wir wurden damals im Deutschen Reich fürsorglich aufgenommen,
und mein Vater, der mehrere Sprachen beherrschte – Deutsch, Russisch, Litauisch und Lettisch - wurde aufgrund seiner Fähigkeiten schnell in die Wehrmacht integriert. Diese plurilinguale, also mehrsprachige Ausbildung und die Fähigkeit, sich in unterschiedlichen Kulturen zu bewegen, haben auch mich geprägt. Ich habe früh gelernt, mich in den gegebenen Verhältnissen zu engagieren, aber immer mit einem kritischen Hintergedanken, der mich dazu brachte, die Dinge differenziert zu betrachten.
Diese Erfahrungen haben mir geholfen, in schwierigen Zeiten immer wieder nach vorne zu schauen. Sie haben mir Resilienz gegeben und eine Haltung, die geprägt ist von Anpassungsfähigkeit und der Fähigkeit, in Herausforderungen Chancen zu sehen.“
3. Sie forschten an der Säuglingssterblichkeit, an deren Senkung. Sie prägten die Ausbildung und Forschung im Bereich der Sozialhygiene maßgeblich mit. Das war nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich von großer Bedeutung. Was haben Sie aus dieser Zeit über das Miteinander und die Verantwortung in einer Gesellschaft gelernt?
„Die Forschung zur Senkung der Säuglingssterblichkeit und mein Engagement in der Sozialhygiene waren nicht nur berufliche Aufgaben, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Ich gewann dabei eine zentrale Erkenntnis: Der Erfolg einer Gesellschaft liegt in der organisierten Verantwortung und im koordinierten Miteinander.
Die Sozialhygiene war in der DDR zunächst wenig anerkannt, obwohl sie bereits im Deutschen Reich ihren Ursprung hatte. Sie ging über die klassische Sozialmedizin hinaus und umfasste die Organisation und Verhinderung von Krankheiten in soziologischer, ökonomischer und rechtlicher Hinsicht. Es war mir wichtig, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern die tieferen sozialen und strukturellen Ursachen anzugehen.
Ein Schlüsselmoment war die drastische Senkung der Säuglingssterblichkeit im Bezirk Rostock. Die Situation war alarmierend, mit Sterblichkeitsraten von fast 10 Prozent. Unsere erste Maßnahme war, die Todesursachen lückenlos zu analysieren. Dafür sorgten wir, dass jeder verstorbene Säugling obduziert wurde – eine Aufgabe, die ich anfangs selbst organisierte, indem ich die Leichname teilweise persönlich transportierte. Das war nicht angenehm, aber notwendig.
Aus diesen Erkenntnissen entwickelten wir ein ganzheitliches System: Wir verknüpften die medizinische Versorgung mit fürsorgerischen Maßnahmen, dokumentierten akribisch die Vorgänge bei jeder Geburt und jeder Behandlung und identifizierten Schwachstellen – sei es im Gesundheitswesen, in der Infrastruktur oder in den Familien selbst. Es war harte Arbeit, aber nach acht Jahren war der Bezirk Rostock mit einer Säuglingssterblichkeitsrate von unter 2 Prozent führend in der DDR. Dieses Modell wurde schließlich landesweit übernommen und später sogar von der WHO als Beispiel für andere Länder empfohlen.
Was ich dabei über das Miteinander und die Verantwortung in einer Gesellschaft gelernt habe? Folgendes: Nur durch ein enges Zusammenspiel aller Beteiligten – Ärzte, Fürsorgekräfte, Familien und staatliche Stellen – können solche Probleme gelöst werden. Es braucht Organisation, aber auch menschliche Nähe. Die Fähigkeit, Schwächen offen anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu suchen, war entscheidend. Diese Zusammenarbeit, dieses Verantwortungsgefühl füreinander, ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe.“
4. In den 80er Jahren vertraten Sie das Rote Kreuz der DDR international und fungierten auch als Vizepräsident der Kommission für Gesundheit und Soziale Dienste der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC).
Herr Prof. Dr. Akkermann, mit Ihrem internationalen Wirken – sei es im Irak, in den USA oder beim IFRC – haben Sie über Länder- und Systemgrenzen hinweg Brücken gebaut. Wie bewerten Sie rückblickend diese Erfahrungen in Bezug auf die heutige globale Zusammenarbeit?
„Die 1980er Jahre waren eine besondere Zeit. Damals waren die Fronten zwischen den politischen Blöcken – Ost und West – zwar klar abgesteckt, aber gerade diese Klarheit brachte auch eine gewisse Disziplin mit sich. Beide Seiten waren sich der Gefährlichkeit der gegenseitigen Bedrohung bewusst, insbesondere was die Atomwaffen anging. Diese Rationalität und der gegenseitige Respekt ermöglichten es letztlich, den Kalten Krieg ohne eine große Katastrophe zu beenden.
Mein Wirken im internationalen Kontext, sei es bei Gastprofessuren im Irak, in den USA oder beim IFRC, war geprägt von der Überzeugung, dass Brückenbau zwischen Ländern und Systemen möglich und notwendig ist. Ich habe erlebt, wie zivilgesellschaftliche und pazifistische Kräfte, getragen von Konfessionen und Organisationen wie dem Roten Kreuz, eine wichtige Rolle spielten, um Spannungen abzubauen. Es waren nicht nur die Großmächte, sondern auch diese zivilen Akteure, die zur Stabilisierung beitrugen.
Was mir dabei immer wichtig war, war die Einsicht, dass globale Zusammenarbeit nur funktioniert, wenn man über ideologische und kulturelle Grenzen hinweg gegenseitige Anerkennung und Respekt entwickelt. Diese Erfahrungen haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, den Dialog aufrechtzuerhalten, selbst in schwierigen Zeiten.
Rückblickend sehe ich allerdings, dass die heutige globale Zusammenarbeit vor anderen Herausforderungen steht. Die multipolare Welt mit dominanten Akteuren wie den USA, China und aufstrebenden Nationen wie Indien ist komplexer geworden. Wissenschaftliche und technologische Entwicklungen, die früher oft international geteilt wurden, sind heute stark national geprägt und werden häufig als Machtinstrumente genutzt.
Dennoch: Ich habe gelernt, dass nachhaltige globale Zusammenarbeit nur dann möglich ist, wenn sich Länder ihrer Grenzen und Potenziale bewusst sind und bereit sind, auf Augenhöhe zu kooperieren. Das erfordert Ehrlichkeit, Respekt und die Fähigkeit, Widersprüche produktiv zu lösen. Das waren damals die Schlüssel zu meiner Arbeit, und das sind auch heute die Prinzipien, die ich für eine funktionierende Weltgemeinschaft als essenziell erachte.“
5. Zum Abschluss: Gibt es eine Botschaft, die Ihnen besonders am Herzen liegt, die Sie mir und allen Jüngeren mitgeben möchten – sei es für das Leben, die Gesellschaft oder unsere persönliche Haltung in einer sich ständig wandelnden Welt?
„Ja, es gibt tatsächlich etwas, das mir sehr am Herzen liegt. In einer Welt, die sich immer schneller wandelt, möchte ich vor allem auf zwei Dinge hinweisen, die für unser Leben, unsere Gesellschaft und unsere persönliche Haltung entscheidend sind: Ehrlichkeit und die Fähigkeit, Grenzen und Potenziale zu erkennen.
Ehrlichkeit ist die Grundlage für jede funktionierende Gemeinschaft, sei es in der Familie, in der Gesellschaft oder auf globaler Ebene. Wir leben in einer Zeit, in der Täuschung und Verschweigen oft den Ton angeben, aber ohne Ehrlichkeit kann kein echtes Vertrauen entstehen. Dieses Vertrauen ist jedoch die Basis, um die großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern.
Was die Grenzen und Potenziale betrifft, so ist es wichtig, dass jeder Einzelne, aber auch jede Gesellschaft versteht, was sie leisten kann und wo ihre natürlichen Grenzen liegen. Nur so können wir unser Handeln realistisch ausrichten und unsere Kräfte effektiv einsetzen, statt uns in Illusionen zu verlieren. Das gilt auch auf globaler Ebene – wir dürfen weder unsere Möglichkeiten überschätzen noch unsere Verantwortung unterschätzen.
Zwei konkrete Themen, die mir besonders wichtig sind, möchte ich hervorheben. Erstens die Klimakrise: Wir müssen sie ernst nehmen und aktiv handeln, aber ohne uns in einem isolierten Vorreitertum zu verlieren. Es ist entscheidend, alle mitzunehmen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, anstatt uns allein zu überfordern. Zweitens die Vermeidung eines großen Krieges: Ich habe als Rotkreuz-Präsident die Vernichtungspotenziale auf beiden Seiten erlebt und weiß, wie wichtig es ist, Eskalationen zu verhindern. Ein solcher Konflikt würde für uns alle katastrophale Folgen haben.
Meine Botschaft an die jüngeren Generationen lautet: Seid ehrlich zu euch selbst und zu anderen, bleibt offen für Dialog, und habt den Mut, eure Fähigkeiten in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Es liegt an euch, die Balance zwischen Fortschritt und Verantwortung zu finden und eine Welt zu gestalten, die sowohl lebensfähig als auch lebenswert bleibt.“
Herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch, Herr Prof. Dr. Akkermann. Ihre Einblicke in ein bewegtes Leben und Ihre klaren Botschaften für die Zukunft sind beeindruckend und bereichernd.
Für alle, die mehr über seine Erkenntnisse und visionären Gedanken erfahren möchten, empfehle ich sein Buch „Die ewige Sehnsucht“. Besuchen Sie auch seine Homepage www.siegfried-akkermann.de, um tiefer in die Themen einzutauchen, die ihn bewegen.
Das Gespräch führte Antje Habermann, DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.